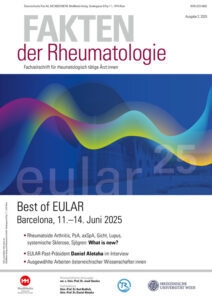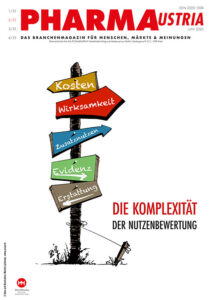Psychosomatik und Urologie am Beispiel des rezidivierenden Harnwegsinfekts
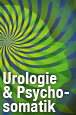
Blasenentleerung und lokale Immunabwehr: Das postkoitale Vorkommen von Bakterien im Harn ist üblich, allerdings normalerweise nur vorübergehend und asymptomatisch6, 7. Ebenso sind die Adhäsion der Bakterien an die Blasenschleimhaut und die nachfolgende Interaktion individuell verschieden, wobei diese Adhäsion sogar noch variabel ist; Phasen niedriger Adhärenz gehen mit infektfreien Intervallen einher7, 8. Diese Beobachtungen legen nahe, dass eine funktionelle obstruktive Blasenentleerungsstörung dafür ursächlich sein kann, dass bei den Betroffenen postkoital eine persistente Bakteriurie mit später symptomatischem Harnwegsinfekt resultiert; und dass situativ auftretende immunologische Veränderungen ein zweiter Faktor sein können.
Funktionelle Blasenentleerungsstörung: Ebenso wie die rezidivierende Zystitis findet sich die funktionelle obstruktive Blasenentleerungsstörung häufig. Sie reicht von einer nur fehlenden Willkürkontrolle über den Beckenboden bis hin zur Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination; infektbahnende Folgen sind der erhöhte Sphinktertonus und die Detrusorhyperaktivität9–11. Bei beiden Symptomen ist ein ähnlicher psychosomatischer Hintergrund beschrieben5. Dies wird verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Miktion eine über die bloße Diurese hinausgehende Bedeutung für den Einzelnen erlangen kann.
Psychosomatischer Hintergrund: 1905 beschreibt Freud den Zusammenhang zum Ehrgeiz, einen Lustgewinn durch das Zurückhalten der Miktion – das Erlernen der Sphinkterkontrolle im Kleinkindalter lässt erstmals Autonomie erfahren, lässt eine Verbindung zwischen Miktion und Ich-Gefühl entstehen12. Das Wahrnehmen des unteren Harntrakts hat mit Selbstregulation, Macht und Kontrolle zu tun. Ein urologisches Symptom kann also den Zweck der Selbst-Wahrnehmung erfüllen bei Gefühlen von Minderwertigkeit und Ausgeliefertsein13, 14.
Diese Theorie unterstützend, lässt die biografische Anamnese betroffener Frauen eine Störung in der Selbstregulation als Ursache für die Entstehung rezidivierender Zystitiden finden. Das Auftreten der Infekte dient anscheinend zur Kompensation des gestörten Selbst(wert-)Gefühls. Typischerweise also manifestiert sich der Infekt postkoital als Folge einer Situation, die schutzlose Hingabe, Sich-Hergeben, Sich-Gehenlassen-Können einfordert5, 15, 16.
Typische Merkmale der Patientinnen: Anamnestisch findet sich ein Zusammenhang zwischen Infekten und Liebesenttäuschung, oftmals geht der Entwicklung eine Kränkungssituation voraus17.
So sind koinzident oftmals die Aufnahme einer Paarbeziehung oder deren Veränderung, wie ein gemeinsamer Urlaub oder das Zusammenziehen. Auch familiäre Ereignisse können auslösend sein, z. B. der Tod eines nahestehenden Angehörigen. Entsprechend bildhaft ist das durch die Zystitis bedingte Bedürfnis nach Wärme, auch nach Nestwärme der Familie, nach Ruhe, nach Rückzug5, 16.
Gemeinsam findet sich bei Betroffenen die Kombination aus einer sowohl aggressiv-wehrhafter Haltung wie aber auch aus Nicht-Loslassendem und Festhalten-Wollendem. Erkennbar sind Schwierigkeiten in der Abgrenzung, beim Hinter-sich-Lassen und bei Kontrollverlust. So gingen unkomplizierte Beziehungen oder Phasen, in denen die Frauen wenig emotional engagiert waren, ohne Infekte einher. Das Problem trat erst mit zunehmender emotionaler Abhängigkeit (wieder) auf, mit der Notwendigkeit, sich wirklich einlassen zu müssen15, 16.
Ich-Schwäche als emotionaler Auslöser: Typisch für die Betroffenen ist ein vordergründig selbstbewusstes Auftreten, das die darunterliegende Selbstwertregulationsstörung kaschiert. Erst gezielte Exploration und Schlüsselszenen lassen die Ich-Schwäche der Patientin erkennen5. Häufig ist in der Praxis für uns Ärzte eindrücklich zu sehen, wie eine erwachsene Frau nicht in der Lage ist, ihrer Mutter das Einmischen in die Behandlung zu verwehren, sogar deren oftmals grenzüberschreitende oder lieblose Äußerungen ohne Erwiderung mit sich zurückziehender Körpersprache stehen lässt.
Zentraler Autonomie-Konflikt: Der eigentliche Beziehungskonflikt ist nicht das soziale Gefüge zum Zeitpunkt der Infekte an sich, sondern nach Diederichs die nicht abgeschlossene Auseinandersetzung mit der übermächtigen und ihre Tochter nicht mit Respekt behandelnden Mutter, wodurch die Patientin dominiert und an der eigenständigen Entwicklung gehindert wurde5. So ist der Auslöser die so gut bekannte Emotion, psychischen Stress zu empfinden, sich klein und fremdbestimmt zu fühlen. Der zentrale Konflikt liegt nach Diederichs darin, dass ein schwankendes Selbstwertgefühl regressive Wünsche und die Sehnsucht nach Verschmelzung mit einem stützenden Objekt weckt, diese aber aus Angst vor neuerlicher Verletzung und Selbstaufgabe abgewehrt werden müssen5.
Zystitis statt Grenzen-setzen-Können: Die urologische Symptomatik zeigt die noch fehlende Loslösung aus der Tochter-Rolle auf, sie weist auf die Problematik in der persönlichen Abgrenzung und Selbst-Verwirklichung hin. Entsprechend besteht der sekundäre Krankheitsgewinn im Wiederherstellen körperlicher Distanz zum Selbst-Schutz5. Verständlich ist dadurch der oftmals so typische progrediente und „sich verselbständigende“ Krankheitsverlauf, der Infekte bald nicht mehr nur postkoital, sondern in den verschiedensten Situationen auftreten lässt. Auslösend ist dann jede Art von emotionalem Stress, wie Überforderung und Anspannung, Verlust- und Versagensängste, Mobbing, Unzufriedenheit und Unwohlsein.
Erhöhte physische Spannung: Folglich kann die antibiotische Therapie jeweils nur rein symptomatisch und nicht kurativ sein. Es ist gut verständlich, dass diese Frauen – parallel zur inneren Spannung – sich selbst in der Regel als physisch „verspannt“ und nicht zur Entspannung fähig beschreiben. Erwartungsgemäß lassen sich meist ein erhöhter Beckenboden-Tonus und fehlende willkürliche Relaxierbarkeit des Sphinkters bei Miktion diagnostizieren.
Psychoneuroimmunologie: Die immunologische Komponente betrachtend, besteht eine komplexe bidirektionale Interaktion zwischen dem ZNS, dem endokrinen System und dem Immunsystem. Über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse und die Sympathikus-Nebennieren-Achse kann eine Dysregulation des Immunsystems verursacht werden, aus der eine durch neuroendokrine Hormone veränderte Freisetzung von Zytokinen erfolgt. Diese Gehirn-Immunsystem-Interaktionen werden psychisch moduliert und sind durch Stress beeinflussbar, wie anhand zellulärer und humoraler Parameter bei Mensch und Tier nachweisbar war18–20.
Immundefizit durch Stress: Dieses Phänomen ist gut dokumentiert bei einer Vielzahl von Erkrankungen und dem Ansprechen auf eine Therapie mit Vaccinen18, 21–26. Auch bei Tumorerkrankungen und Metastasierung konnte bezüglich Progress und Sterblichkeit ein psycho-neuro-immunologisches Risiko nachgewiesen werden: ist die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse durch Stress und Depression permanent aktiviert, bedingt dies eine Verschlechterung der Immunantwort, die zytotoxischen T-Zellen und die Aktivität der natürlichen Killerzellen nehmen ab22, 27.
Psychovegetative Dysbalance: Zusammenfassend ergibt sich für beide Faktoren, sowohl die funktionelle Blasenentleerungsstörung als auch das lokale Immundefizit des unteren Harntrakts, dasselbe pathophysiologische Korrelat: Stress, emotionale und konsekutiv physische Anspannung. Entsprechend muss eine kurativ ausgerichtete Therapie das Entstehen von Stress beseitigen und die psychovegetative Balance wiederherstellen.
Therapie: Die fachurologische psychosomatische Grundversorgung kann der Patientin ermöglichen, ihr Reaktionsmuster und die darunterliegende innere Not wahrzunehmen, den zentralen Konflikt und den emotionalen Auslöser zu verstehen. Mentaltraining und Ausgleich der Ich-Schwäche sowie das Kennenlernen alternativer Sichtweisen und Verhaltensmuster ermöglichen den Frauen persönliches Wachstum – das Entwachsen aus ihrer Kind-Rolle und das Für-sich-einstehen-Können ohne emotionalen Stress. Gelegentlich kann dies aber auch erst nach einer psychotherapeutischen Verhaltenstherapie möglich sein5. Darüber hinaus sind eine effiziente Beckenboden-Edukation mit Erlernen willkürlicher Sphinkter-Relaxation sowie die Anleitung zum Erlangen psychischer Gelassenheit und physischer Entspannung indiziert. Unterstützt werden kann dies je nach individueller Voraussetzung durch progressive Muskelrelaxation oder andere Techniken. Bis ein Therapieerfolg erreicht sein kann, ist als flankierende Maßnahme die übliche Infektmetaphylaxe mit z. B. mehrmonatiger antibiotischer Low-Dose-Therapie, pflanzlichen Präparaten und Immunmodulation sinnvoll.
Take Home Message
Zum Verständnis der psychosomatischen Hintergründe urologischer Erkrankungen ist die Betrachtung interpersoneller Prozesse hilfreich. So kann z. B. die rezidivierende Zystitis durch eine Problematik in der persönlichen Abgrenzung und Selbstbestimmung mitbedingt sein. Effektiv ist hier ein multimodaler Therapieansatz aus fachurologischer psychosomatischer Grundversorgung bzw. ggf. auch psychotherapeutischer Verhaltenstherapie, professioneller Beckenboden-Edukation, Entspannungstechniken und üblicher medikamentöser Infektmetaphylaxe.